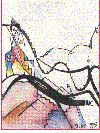9,15 - 9,30
Eröffnung durch den Prorektor für Forschung der
Albert-Ludwigs-Universität, Prof. Dr. St. Pollak
9,30 - 10,00
Fischer / Schäffler / Sonntag, Freiburg: Sprachfreie auditive Differenzierung:
Diagnostik, Training und Transfer auf sprachgebundene Leistungen
10,00 - 10,30
D. Berwanger, München: Zeitverarbeitung bei Kindern mit
Sprachentwicklungsstörungen - beurteilt anhand von 'Ordnungs-' und 'Fusionsschwelle'
10,30 - 11,00 Pause
11,00 - 11,30
P. Matulat, Münster: Die binaurale Interaktionskomponente der frühen
akustisch evozierten Potentiale. Ein Ansatz zur objektiven Diagnostik auditiver
Selektionsstörungen?
11,30 - 12,00
G. Schulte-Körne, Marburg: Zur Bedeutung der mismatch-negativity (MMN) und zu
ihrem Einsatz
12,00 - 12,30
Brandeis / Drechsler / Maurer, Zürich: Neurophysiologisches Mapping von
Lesenlernen und Dyslexie-Risiko
12,30 - 14,00 Mittagspause
14,00 - 14,30
Hennighausen / Schecker, Freiburg: Zum Zusammenhang von
Aufmerksamkeits- und Sprachentwicklungsstörungen (auf der Basis neuropsychologischer
Daten)
14,30 - 15,00
Schecker / Hennighausen, Freiburg: Hirnelektrische Ableitungen bei
sprachentwicklungsgestörten Kindern: Fragestellung und Problemhorizont
15,00 - 15,30
G. Kochendörfer, Freiburg: Zur 'neuronalen Realität' von Silben und Phonemen
15,30 - 16,00
L. Glass und B. Sabisch, München: Akustisch und visuell evozierte P3 bei
sprachentwicklungsgestörten Kindern - unter Berücksichtigung topographischer
Gesichtspunkte
16,00 - 16,30
R. Uwer, München: Altersentwicklung hirnelektrischer Potentiale
16,30 - 17,00 Pause
17,00 - 17,30
B. Fischer, Freiburg: Zur Wirkung von Ritalin auf visuelle und auditive
Wahrnehmungsstörungen
17,30 - 18,00
Schulz / Hennighausen, Freiburg: Wann und warum Ritalin?
18,00 - 18,30
Podiumsdiskussion "Ritalin": Hennighausen, Freiburg / Schecker,
Freiburg / Schellberg, Basel / Weber, Basel
19,00
'Ausklang' (Orgelkonzert in der Freiburger Universitätskirche)